- Ein Schwein findet in Schöningen das Salz
- Salzgewinnung bis 1747
- Über die Salzwerke bei Schöningen
- Die herzogliche Saline 1747 – 1840
- Die herzogliche Saline 1841 – 1908
- Salzsiedung in Carlshall
- Neuhall 1907 – 1940
- Neuhall 1940 – 1970
- Das Kraftwerk
- Bahnanschluß Neuhall
- Bohrfelder
- Salzverkauf und Vertrieb
- Eigentümerentwicklung ab 1924 und Schließung der Saline
- Anhang: Das Salzmännchen
Texte zur Ausstellung im Heimatmuseum Schöningen 2017
Ein Schwein findet in Schöningen das Salz
An einem stürmischen Novemberabend saß die Großmutter mit ihren Enkeln am warmen Ofen. Da fragte sie: „Kinder, wißt ihr eigentlich, wie die Saline entstanden ist?“ Sie wußten es nicht, und so erzählte die Großmutter:
„Vor vielen, vielen Jahren lebte in Schöningen ein reicher Bauer. Er hatte einen großen Hof, der dort lag, wo heute die Bohrtürme der Saline stehen. Schöne Pferde und Kühe hatte er, aber sein größter Stolz waren die Schweine, die nirgends so prächtig gediehen wie bei ihm.
Eines Tages zeigte der Bauer einem Freund sein Lieblingstier, eine muntere Sau mit schwarzen und weißen Flecken und einem lustigen Ringelschwanz. Übermütig sprang sie im Hofe umher, wühlte hier und wühlte dort, wälzte sich im morastigen Tümpel und untersuchte mit ihrem Rüssel den Schlamm nach etwas Essbarem – wie Schweine es eben so tun.
Plötzlich stutzte das Tier, schnüffelte unruhig am Boden, prustete einige Male heftig und fing wie rasend an zu wühlen. Der Bauer schüttelte den Kopf, als er das sah. Er wollte das Tier fortjagen, aber es gelang ihm nicht. Da brach unvermutet ein gewaltiger Wasserstrahl aus der Erde. Erschrocken flüchteten Bauer und Schwein. Aber der Bauer war nicht schnell genug, so dass er völlig durchnässt war. Als er sich über die Lippen leckte, bemerkte er, dass sie ganz salzig schmeckten. Er war ganz erstaunt und leckte immer wieder. Dann befahl er einer Magd, einen Topf voll von diesem Wasser zu holen. Er probierte es, und siehe da, es war so salzig, dass er es nicht trinken konnte! Aufgeregt reichte er den Topf an seinen Freund weiter. Der nahm gleich einen großen Schluck und lief sofort rot an und würgte. Seine Frau musste sich um ihm kümmern, und er eilte sogleich zu der merkwürdigen Quelle. Sie war inzwischen versiegt; doch um das Loch herum befand sich eine dünne Salzschicht.
Bald darauf ließ er seine Knechte an der Stelle tiefer in der Erde graben, um vielleicht mehr Salz zu finden. Sie gruben zwei volle Tage lang, fanden aber nichts und wollten schon entmutigt aufgeben. Doch plötzlich rief der Jungknecht: „ Leute, Salz! Salz!“ Und wirklich – er hatte es gefunden. Man grub weiter und fand eine großeSalzquelle. An dieser Stelle entstand dann nach und nach unsere Saline.“
Salzgewinnung bis 1747
Die ersten urkundlichen Erwähnungen von den Schöninger Salzquellen aus dem Jahr 1112 lassen darauf schließen, dass die Salzsiedung in Pfannen schon sehr lange vor dieser Zeit betrieben wurde. 1112 werden die Pfalzgrafen von Sachsen auf der Sommerschenburg als Salzgrafen der Schöninger Salzquellen bezeichnet.
Auf die wechselenden Besitzverhältnisse und Ansprüche auf Salzanteile bis 1747 wird auf das Heimatbuch der Stadt Schöningen III.Teil von Karl Rose verwiesen.
Die Salzsole trat in 2 Quellen zutage, die ca. 800 Meter südlich der Schöninger Stadtgrenze lagen. Die Quellen, die 220 Schritte voneinander entfernt waren, wurden im Laufe der Zeit, um sie ergiebiger zu machen, als Brunnen ausgebaut und zum Schutz gegen Regen mit strohbedeckten Holzhäusern überbaut.
Ein Brunnen hieß „de Röpper Born“. Er hatte seinen Namen davon, dass er etwas weiter hinauf (heropp) bei den Salzkoten lag. Er war ca. 33 Meter tief und lieferte täglich ca. 7 cbm Sole. Um diesen Brunnen herum lagen die Salzkoten. Es waren strohgedeckte Hütten aus lehmbeworfenem Fachwerk ohne Schornstein.
Der zweite Brunnen hieß „de Butter=Butten Born“ weil er butten oder weiter entfernt (ca. 250 m) von den Koten gegen Westen lag. Die zwei Quellen des Brunnen lieferten täglich ca. 23 cbm Sole mit einem Salzgehalt von 4 -5 %.
Beide Brunnen lieferten zusammen Sole für eine Jahres-gewinnung von etwa 14.000 Zentner Siedesalz.
Der Zustand der Solequellen wurde über die Jahrhunderte nicht wesentlich verändert. Die Sole wurde durch menschliche Kraft mit großen Kübeln an eisernen Zugketten mittels eines großem Schwungrades aus den Brunnen geschöpft und dann durch Holzleitungen in die um die Brunnen herum gebauten 13 Koten geleitet. Dort wurde die Sole in hölzernen Bottichen gesammelt, um eine gleichmäßige Sole zu bekommen.
Erst um 1515 wurde ein Tretrad zum Antrieb der Zugketten eingesetzt.
Die Sole wurde in eisernen Pfannen mit 300 l Inhalt gesiedet. Sie lagen auf in den Erdboden eingelassenen steinernen Herden. Geheizt wurde mit Stroh, Torf oder Holz, je nachdem, was dem Kotenbesitzer als Brennmaterial zur Verfügung stand. Ein Siedevorgang dauerte 3 bis 4 Stunden. Das geschöpfte Salz wurde dann in Körben oder Holztrögen in den Koten getrocknet.
Die eisernen Pfannen mussten regelmäßig nach mehreren Tagen Sieden von dem sogenannten Pfannenstein, der sich aus Gips und Salz am Rand bildete, gereinigt werden.
Aufgrund der geringen Salzkonzentration wurde viel Brennmaterial zum Sieden benötigt (2/3 der gesamten Herstellungskosten). Dadurch war die Saline Schöningen von den Kosten her im Nachteil gegenüber anderen Salinen wie Juliushall (Goslar), Salzgitter und Liebenhall.
Zwischen 1720 und 1740 gelangten 10 der 13 Koten in den Besitz der Familie Köhler. Der Amtsrat Christoph Daniel Köhler versucht ab 1742 den Brennstoffbedarf durch Änderungen an der Feuerung zu reduzieren, um die Saline profitabler zu machen.
Der Absatz des Schöninger Salzes wurde von der herzogl. Verwaltung durch Erlasse im Braunschweiger Land gefördert. Die Zollschranken der Kleinstaaterei verhinderten aber weitgehend den Absatz in andere Kleinstaaten und verteuerten durch die erhobenen Zölle das Salz.
(Quelle: Heimatbuch der Stadt Schöningen III.Teil von Karl Rose, 1940 Hrsg. Stadt Schöningen)
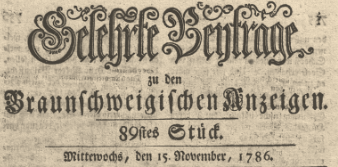
Gelehrte Beiträge zu den Braunschweigischen Anzeigen (Teil 2),Mittwochs, 15. November, 1786
Über die Salzwerke bei Schöningen
Den eigentlichen Betrag des Salzes, das hier jährlich gesotten wird, kann ich Ihnen nicht genau bestimmen, weil ich davon nicht gehörig unterrichtet bin. Ehemals pflegte man wöchentlich auf jede Pfanne 80 Stück, oder 20 Himpten zu rechnen. Das betrüge jährlich eine Summe von 13.520 Himpten Salz. Wahrscheinlich wird aber jetzt, nachdem die innere Einrichtung des Salzwerkes sehr verbessert ist, die Summe des jährlich zu siedenen Salzes weit höher steigen. Der natürliche Gedanke, der jedem einfallen muß, wenn er diese Salzkoten und Salzquellen in Augenschein nimmt, ist wohl der, Woher diese Quellen ihr Salz erhalten, um jährlich einen so ansehnlichen Vorrat davon absetzen zu können? Dieser Gedanke ward noch Iebhafter in mir, als ich hier gleich neben dem schönsten süßen Quell,
dem so genannten Klingebrunnen, einen Salzquell entspringen sah. Leibniz glaubt, bei der allgemeinen Revolution der Erde, da Meere versunken, und ehemaliger Meeresgrund trocken Land geworden, hätten sich große stehende Seen unter der Erde gesammelt, das darin befindliche Salz wäre nach und nach verhaftet, und das Wässrige davon verdunstet. Von der in der Erde sich sammelnden Regen- und Schneewasser entstünden Quellen, welche durch dieses verhärtete Salz ihren Lauf nahmen, und uns die Sole, als davon abgerissene Teilchen, zuführten.
Aber so wahrscheinlich dieses alles ist, Wozu eben diese Verhärtungen? Warum wollen wir nicht ursprüngliche Salzfelsen annehmen, die schon mit dem Meere selbst existierten? Wenigstens lassen uns die unerschöpflichen Salzbergwerke bei Bochnia und Wieliczka dieses vermuten. Wahrscheinlich gibt es also auch in den Eingeweiden unseres vaterländischen Bodens einen solchen Salzberg, aus dessen Schoß wir einen so reichen Schatz von Sole erhalten. Und wie sehr wäre es zu wünschen, daß dieser Felsen einmal entdeckt würde! Als denn wären alle jene kostbaren Gebäude und ihre Erhaltung nicht nötig, durch deren Hilfe die Sole wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück versetzt wird. Unsere Forsten konnten geschont oder ihr Holz an Ausländer verhandelt werden und statt 6000 Zentner jährlich viele 100.000 gewonnen werden. Nicht zu denken, daß das Steinsalz viel härter, weißer und stärker ist als das“ künstliche. Unsere Salzbrenner und Arbeiter müßten sich denn freilich eine kleine Verwandlung gefallen, und in Bergleute umformen lassen. Statt daß sie jetzt in Hütten und Koten über der Erde wohnen, würden sie als denn das Tageslicht nur selten zu sehen bekommen, und unter der Erde zwischen kristallenen Wänden ihre Wohnplatze angewiesen erhalten. Doch dieser Wunsch gehört, wie so viele andere, unter die frommen Wünsche, die nie in Erfüllung kommen werden.
Ich will Sie daher, bester Freund, lieber noch, so viel ich Raum übrig habe, mit der alten Geschichte dieses Salzbrunnens bekannter machen. Er liegt ja in unserem Lande, wie wir selbst genießen seiner Wohltat täglich. Verdient er also nicht eher, als jeder andere merkwürdige Brunnen, daß wir näher kennenlernen? Ich verdanke aber dieser und anderer Nachrichten, welche ich Ihnen hier mitteile, und welche ich bereits eher hätte sagen sollen, dem dasigen Herrn Rektor Ballenstedt, der großer Kenner der Geschichte unseres Landes ist, ein Verdienst, wonach gewöhnlich nur wenige streben, weil dieses Studium und selten für dem Fleiß belohnt, den man darauf verwenden muß.
Die Entdeckung dieses Salzbrunnens verhüllt sich in das entfernteste Altertum. Im Jahre 1120 wird indessen desselben zuerst erwähnt. Er muß aber schon längst vorher im Gange gewesen sein, weil er schon mit unter den Schenkungen stehet, welche die Fürstin Oda dem dasigen Kloster gemacht hat. Wenigstens ist er älter als die Salzwerke zu Salzdahlum, Salzliebenhalle und Harzburg. Er war also damals der einzige Salzbrunnen in der Gegend. Denn der zu Salzdahlum ist erst im 13.]ahrhundert bekannt geworden. So auch der zu Salzliebenhalle oder Salzgitter, welcher 1273 versiegte. Aber wie eine Chronik sagt, nach einer mit Kreuzen und Fahnen angestellten Prozession wieder aufgefunden, und 1534 vom Herzog Heinrich dem Jüngeren von den Gewerken erhandelt sein soll. Das Salzwerk zu Bad Harzburg, Juliushalle genannt, ist erst vorn Herzog angelegt worden.
Auch die Salzgrafschaft über die Gewerke gibt uns ein hinlängliches Recht; das Altertum und die Weitläufigkeit dieses Salzwerkes zu behaupten. Denn diese Salzgrafschaft haben die Salzgrafen von Sachsen zur Sommerschenburg längst vor Errichtung des Klosters Lorenz zu Schöningen gehabt. Sie verloren dasselbe um das Jahr 1112 und mußten sie der adligen Familie von Heimburg überlassen. Nachher 1484 wurde die Familie von Veltheim vom Haus Braunschweig damit belehnt. Diese Familie trat sie endlich gegen eine Vergütung wieder ab, und seitdem ist das Salzwerk zu einem Fürstlichen Kammergut gemacht worden.
Ich merke hier noch Folgendes an. Ein Salgreve (Salzgraf)hatte die Obergerichtsbarkeit über die Gewerke, die ihre eigene Kompetenz und Rechte hatten, und mußte alles das abtun, was der judex ordinarius , der Großvoigt mit seinem Kleinvoigt auf dem Söltergelage nicht schlichten und bestrafen konnte.
Von dem vormaligen Zustand dieses Salzwerkes, von den Erbenzinsherren und den ehemaligen Inhabern der Koten, ehe sie ein fürstliches Kammergut wurden, gibt der ehemalige Rektor Cuno in seinem Buche, Memorabilia Scheningensia betitelt, so viel Nachricht, als ihm aufzufinden möglich war. Ich könnte Ihnen dieses abschreiben, aber ich will sie nicht länger damit aufhalten, weil es zu sehr ins Kleine geht. Über dem mußte sich Cuno meistens mit Überlieferungen behelfen, weil das Archivs des Rathauses in dem großen Brando, den die Stadt den 30. Juli 1644 erlitten, ein Raub der Flammen geworden, und in der Salzwerkenlade wenig Nachrichten zu finden gewesen sind.
Vergönnen Sie also nur noch eine Anmerkung zu machen. Sie kennen den wahren Wert der Dinge zu gut, als daß Sie dieses Salzwerk der Aufmerksamkeit unwert achten sollten. Was ist nicht diese Salzquelle für eine Wohltat für unsere Gegend! Und wenn wir die ungeheure Menge von Salz, welche unser Land jährlich verbraucht, aus fremden Ländern mit schweren Kosten herbeischaffen sollten, o wie würden wir dann die Städte glücklich schätzen, vor deren Toren die Salzkoten rauchen!
In meinem künftigen Briefe will ich Sie mit den übrigen merkwürdigen Orten und Gegenständen der dortigen Gegend, besonders mit den Versteinerungen bekannt machen. Bis dahin leben Sie wohl.
(Abschrift des Originals, Quelle: NLA WO, 4 Alt 1, Nr. 2048)
Die herzogliche Saline 1747 – 1840
Bereits der Vorgänger von Herzog Carl, Ludwig Rudolf, hatte sich bemüht, die Schöninger Salzherstellung zu fördern. Die herzogliche Unterstützung des Salzhandels wurde von den Schöninger Kotenbesitzern nicht genutzt. Sie passten die Betriebsweise der Salzwerke nicht der Konkurrenzsituation an. Der Salinenbetrieb wurde damit unrentabel.
Herzog Carl hatte großes Interesse, die Wirtschaft in Herzogtum zu fördern und wollte deshalb die Schöniger Salzwerke in staatliches Eigentum übernehmen. 1747 kaufte er sämtliche Salzkoten auf und fand Herrn v. Veltheim in Harbke, der das Lehen des Salzgrafenamtes inne hatte, mit einem Tausch ab.
In den Jahren 1747 – 1749 wurden die 13 Salzkoten abgerissen und durch massive Gebäude ersetzt. Sie enthielten 2 große Siedepfannen, eine Trockenkammer und das Salzmagazin.
Kurz darauf wurde ein weiteres Siedehaus mit einer Pfanne, Trockenkammer und Lager errichtet. Die 3 Pfannen waren aus Eisenblech gefertigt und hatten eine Grundfläche von 40-50 m². Sie wurden von unten statt mit Holz mit Kohle, die in Wefersleben gefördert wurde, beheizt.
Zur Förderung der Sole wurden statt der von Menschen angetriebenen Treträder Wassersäulenmaschinen eingesetzt. Die Verbesserungen wurden von J.G. Mercker ausgearbeitet (Quellen: NLA WO, 4 Alt Nr. 97; Geschichte der Saline Schöningen, Schöningen 1961, S. 14 ff).
Das Siedeverfahren wurde aber nicht wesentlich geändert. Die Salinenpächter erzielten deshalb trotz der Verbesserungen keine Gewinne.
Um die Saline rentabel zu machen, beauftragte Herzog Carl unter anderen in der Zeit von 1760 den Ingenieur Major Winterschmidt mit der Durchführung von Untersuchungen und Versuchen zur Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen.
Winterschmidt erstellte detaillierte Kostenvorschläge und Zeichnungen für
- Ein Gradierwerk, durch das 25% Brennstoffersparnis und eine Verdopplung der Salzmenge erzielt werden konnte.
- Solebehälter, zur Vorratshaltung der konzentrierten Sole
- Pump- und Förderanlagen für eine bessere Ausnutzung der Wasserkraft.
(Quellen: NLA WO, 4 Alt Nr. 68; Geschichte der Saline Schöningen, Schöningen 1961, S. 14 ff).
Das Gradierwerk wurde 1761-1763 auf Anordnung von Herzog Carl dort errichtet, wo heute die Gebäude von MetroFunk Kabel-Union GmbH stehen, das ehemalige Werkstattgebäude von Neuhall.
Da die Gradierung nur in der warmen Jahreszeit wirtschaftlich ist, wurde der aus Eichenholz gebaute Solebehälter so groß ausgelegt, daß er einen dem Winterbedarf entsprechenden Vorrat fasste. Jetzt konnte das ganze Jahr hindurch gesiedet werden.
Die mit dem bisherigen Pächtersystem erzielten Einnahmen – 1.000 Reichstaler pro Jahr – reichten der herzoglichen Regierung nicht aus. Sie setzte deshalb in 1764 einen Administrator ein: Rudolph Adam Abich. Da unter der herzoglichen Verwaltung sich nicht die erwarteten Erfolge einstellten, wurden die Salinen Schöningen und Salzdahlum wieder verpachtet. Der bisherige Verwalter Abich zahlte pro Jahr 6.500 Reichstaler Pacht. Beide Salinen hatten zusammen das Liefermonopol für das Herzogtum Braunschweig Wolfenbüttel (Quelle: Geschichte der Saline Schöningen, Schöningen 1961, S. 14 ff).
Die Wassersäulenmaschinen waren störanfällig und wurden 1767 durch Pumpen ersetzt, die von einem Wasserrad angetrieben wurden. Dies musste 1815 erneuert werden (Quelle NLA WO, 50 Neu 4 Nr. 8092).
Während der französischen Herrschaft hatte die Saline an staatliche Salzmagazine zu liefern und erhielt je Zentner ein bestimmtes Herstellungsentgeld. Nach 1813 ging die Saline wieder in den Besitz des braunschweigischen Staates.
Im Jahre 1840 lief die Pachtzeit des Bergrates Abich (Sohn) aus. Die herzogliche Verwaltung wollte den Pachtvertrag nicht erneuern, weil Abich auf dem Gelände der Saline ohne Genehmigung eine Soda- und Eisenvitriolfabrik errichtet hatte, für die er Sole der Saline nutzte, und weil er sich gegen Neuerungen bei der Feuerung verschloß.
Die herzogliche Saline 1841 – 1908
Von 1841 an wurde die Saline von der herzoglichen Verwaltung betrieben. Erster Administrator war Bergmeister von Seckendorf aus Seesen. Als Salzinspektor war bereit 1834 Ludwig Köhler eingesetzt worden.
1841 schloss sich das Herzogtum Braunschweig dem Zollverein an. Da das Schöninger Salz billiger als in Preußen war, waren die Absatzmöglichkeiten jetzt größer als die mögliche Produktionsmenge. Außerdem hatten die Salinen Schöningen und Salzdahlum bisher nur Teile vom Herzogtum versorgen können.
Deshalb forderte die herzogliche Kammer eine Steigerung der Salzproduktion durch reicher konzentrierte Sole.
Bereits vor 1840 waren in Württemberg große Steinsalzvorkommen in Muschelkalkformationen durch tiefe Bohrlöcher aufgeschlossen worden. Da in Schöningen ähnlicher Erdformationen vorlagen, wurden auf Betreiben des Kammerrates Mahner Tiefbohrungen vorbereitet. Nach eingehenden geologischen Untersuchungen wurde ein Punkt neben der sogenannten Walkenmühle für die erste Tiefbohrung ausgewählt. Mit der Bohrung wurde am 6.1.1845 begonnen. Am 14.5.1847 erreichte man bei 526,58 m das erste Salzlager, das aber unrein war. Bei 571,17 m wurde das Hauptsteinsalzlager erreicht, in das man noch 30,77 weiterbohrte, ohne das Ende zu erreichen. Damit war genug Steinsalz für den größeren Bedarf erschlossen. Ab Mai 1848 konnte die Bohrung I für die Saline gesättigte Sole liefern.
Zur Betriebssicherheit der Saline wurde ab Mai 1849 an der Walkenmühle die Bohrung II niedergebracht, mit der die Mächtigkeit der Salzschicht erkundet wurde. Sie reichte von 542,91 m bis zu 632,40 m Tiefe.
Die gesättigte Sole der Brunnen I und II ermöglichte die Erweiterung der Saline. Es wurde noch ein Siedehaus mit 2 Pfannen und Trockenkammer errichtet.
Das nicht mehr benötigte Gradierwerk wurde abgerissen und die alten Brunnen zugeschüttet. Der Vorratsbehälter des Gradierwerkes wurde als Reservoir erhalten.
Das Bohrloch III wurde neben der Grasmühle im Februar 1855 begonnen. Bei 568,02 m erreichte man am 4.1.1861 das Steinsalzlager.
Die Herstellungskosten des Salzes beliefen sich jetzt durch die Verbesserungen nur noch auf 25% der Kosten vor 1840.
1850 wurde die Saline Salzdahlum stillgelegt.
1859 erhielt Schöningen den Anschluß an die Bahnstrecke Helmstedt – Börßum und 1872 an die Strecke nach Eilsleben. Durch den Bahntransport ermäßigten sich die Transportkosten für das Salz erheblich zum Vorteile des Absatzes.
Die Saline Carlshall konnte pro Jahr maximal 6.000 t Salz erzeugten.
Bis 1907 wurden keine weiteren Veränderungen oder Verbesserungen in der Saline durchgeführt.
Carlshall wurde 1954 nach der erfolgreichen Kapazitätserweiterung von Neuhall stillgelegt.
(Quellen: Heimatbuch der Stadt Schöningen III.Teil von Karl Rose, 1940 Hrsg. Stadt Schöningen; Geschichte der Saline Schöningen, Hrsg. Saline Schöningen 1961).
Salzsiedung in Carlshall
Anhand der im Stadtarchiv vorhandenen 3 Pläne der Saline Schöningen aus dem Jahr 1835 kann die Arbeitsweise der Saline zu der Zeit beschrieben werden.
Die Sole wurde durch Pumpen aus den Brunnen Butten (Putten) und Röpper (Röper) in Rohrleitungen (Röhrenzug) gefördert. Die Pumpen wurden durch mechanische Gestänge mit Wasserkraft angetrieben. Durch Rohrleitungen floß die Sole zum Gradierwerk.
Ein Gradierwerk besteht aus einem Holzgerüst, das mit Reisigbündeln (vorwiegend Schwarzdorn) verfüllt ist. Das Verb „gradieren“ bedeutet „einen Stoff in einem Medium konzentrieren“. Im Falle eines Gradierwerks wird der Salzgehalt im Wasser erhöht, in dem Sole wiederholt durch das Reisig hindurch geleitet wird, wobei auf natürliche Weise Wasser verdunstet. Außerdem lagern sich Verunreinigungen der Sole an den Dornen ab. Dadurch wird die Qualität der Sole erhöht(Quelle: wikipedia). Die konzentrierte Sole wurde dann in den Solebehälter neben den Siedehäusern gepumpt. Vor dort wurde die Sole in die Siedepfannen geleitet. Während des Siedeprozesses in den mit Kohle, Torf oder Holz beheizten Unterkesselpfannen (siehe Gebäudeschnitt) wurde die Sole auf 60 °- 70°C (für gröberes Salz) oder 80 °C (für feineres Salz) erhitzt. Durch diese – im Vergleich zu dem ansonsten heute in der Salzproduktion angewendeten Verfahren – geringe Erwärmung bildeten sich die für das Siedesalz typischen großen Salzkristalle. Es entstehen hohle, mit der Spitze nach unten weisende, aus feinsten Kristallwürfeln zusammengefügte Pyramiden. Beim Absinken der Salzkristalle lagerte sich auch Pfannenstein am Boden der Pfannen ab, der in regelmäßigen Abständen von den Arbeitern entfernt werden mußte (sogenanntes„Pfanneklopfen“). Nach ca. 24 Stunden war das Salz auskristallisiert und wurde von den Arbeitern mit sogenannten Krüken an den Pfannenrand gezogen und auf die Pfannenabdeckung geschaufelt, damit das Salz dort abtropfte. Das so vorgetrocknete Salz wurde dann in die an der Dachkonstruktion angebrachte Hängelorenbahn geschaufelt, in die Trockenkammer gefahren und dort auf den durch die Feuerungsabgase beheizten Dörrflächen (Trockenpfannen) ausgebreitet. Unter mehrmaligem Umschaufeln wurde das Salz dort getrocknet. Danach wurde es ins Magazin geschafft oder gleich zum Versand/Verkauf abgefüllt.
Das Dampf-Luft-Gemisch aus den Pfannen, der Schwaden, zieht durch einen kaminartigen Abzug ins Freie.
Die Kohle, die in Wefersleben gefördert wurde – ab 1841 Braunkohle aus der Nähe von Schöningen -, wurde per Fuhrwerk angeliefert, mußte per Hand entladen und in dem „Torfschuppen“ zwischengelagert werden. Die Feuerung unter den Siedepfannen wurde manuell beschickt und auch entascht.
Der Versand des Salzes erfolgte durch Fuhrunternehmen, deren Fuhrwerke auch von Arbeitern beladen werden mußten.
Der Bahnanschluss von Schöningen 1859 brachte keine Verbesserung hinsichtlich der körperlichen schweren Ladetätigkeiten, da Carlshall kein Bahnanschlußgleis erhielt.
(Quellen: Geschichte der Saline Schöningen, Hrsg. Saline Schöningen der Niedersachsen GmbH, Schöningen 1961; wikipedia; Stadt Archiv Schöningen)
Neuhall 1907 – 1940
1907 wurden Überlegungen und Planungen aufgrund von Anregungen des Salinen-Direktor Gerstner zur Erweiterung der Kapazität von Carlshall angestellt, da der Salzabsatz florierte und die Salinen Schweizerhall, Rheinfelden, Hall, Halem, Aussee, Ischl, Hallstadt Ebensee moderne Einrichtungen hatten (Quelle: NLA WO, 12 Neu 9, Nr. 2444).
1908 begannen die Planungen für den Bau einer neuen Saline mit Grainerpfannen, nach Studienreisen zu Salinen in den Oststaaten der USA. Es wurde ein Vertrag der herzoglichen Salinenkammer mit der Braunschweiger – Elektrizitäts – Betriebsgesellschaft (B-E-B) geschlossen, das diese in der unmittelbaren Nähe zur neuen Saline ein Kraftwerk zu errichten hatte (Quelle: NLA WO, 12 Neu Wirtsch 9, Nr. 2475; Vertrag Saline – B.E.B. vom 9.2.1909; NLA WO, 50 Neu 4, Nr. 9958/5).
1909-10 wurde die neue Saline Neuhall mit 6 Grainerpfannen unter Nutzung des Abdampfes vom Kraftwerk gebaut. Das Elektrizitätswerk der B.E.B lieferte den Sattdampf, um die Grainer-pfannen zu beheizen und Strom, zum Antrieb der Mechanisierung. Die neue Saline wurde im Sommer 1910 eröffnet und war die damals modernste und wirtschaftlichste Saline in Norddeutschland.
1910 wurden Mammutpumpen in die Bohrlöcher eingebaut. Bei Bohrloch I und II mussten dafür die Luftleitungen vergrößert werden. Dadurch wurde eine erhebliche größere Förderleistung erreicht: 130 l/ min gesättigte Sole, entspricht 67.320 m³/ Jahr → 21.500 t Salz. Bohrloch III wurde 4.5.1910 in Betrieb genommen. Es lieferte nach Optimierung 200l/min Sole mit 20% Sättigung → 23.000 t Salz/ Jahr (Quelle: NLA WO, 12 Neu 9, Nr. 2444).
1913-14 wurden 2 weitere Grainerpfannen aufgestellt und 2 Solebehälter mit je 2500 m³ Fassungsvermögen gebaut. Es wurde die 4. Tiefbohrung im Bohrfeld an der „Langen Trift“ niedergebracht, Salzfund bei 396 m Tiefe.
Ab dem 1.10.1921 pachtete die ÜZH das Schöninger Kraftwerk und die von der B-E-B errichteten Versorgungsanlagen.
1922 wurde die Erneuerung der Grainerpfannen wegen starker Korrosion an den Pfannen und der Überdachung zur Brüdenabsaugung erforderlich. Die Überdachung aus Holz musste bereits ab 1913 ständig instandgehalten werden. Die Pfannen und die Überdachungskonstruktion wurden dann in Eisenbeton ausgeführt (Quelle NLA WO K 20641). Trotz der hohen Instand-setzungskosten erzielte die Saline in 1922 einen Reingewinn von 726.500 RM (Quelle; NLA WO, WO, 12 Neu 13, Nr. 50989).
1924 wurde mit Wirkung zum 1. April per Gesetz die Verwaltung und Ausbeutung des brschwg. Grund- und Bergwerksbesitzes auf die neu gegründete Braunschweig G.m.b.H. übertragen (Quelle: Geschichte der Saline Schöningen, Hrsg. Saline Schöningen, 1961).
1925 wurde in Bohrfeld „Lange Trift“ die 5. Bohrung abgeteuft.
Der Vertrag zwischen der Braunschweig G.m.b.H. als Verwaltern und Nutznießer der staatlichen Saline Schöningen und der B-E-B wurde 1927 ergänzt, um die Dampfmenge von 264.000 kg/24h auf 400.000 kg /24 h zum 1.5.1929 durch den Neubau des Kesselhauses zu erhöhen. Damit stand eine größere Abdampfmenge – 30 t/h – zur Verfügung. Zur Ausnutzung des Pfannenbrodems wurde eine Vakuum-Verdampferanlage installiert, womit eine erhebliche Produktionserhöhung möglich wurde (Quelle: NLA WO, 12 Neu 14, Nr. 246).
Am 18.4.1929 ging das neue Kesselhaus in Betrieb. Eine Materialseilbahn versorgte das Kesselhaus mit Kohle von der B.K.B aus Alversdorf.
Am 11.12.1936 übernimmt die Saline (Braunschweig G.m.b.H.) das Kesselhaus des alten Elektrizitätswerkes. Das Vermögen der B-E-B ging auf die ÜZH über.
Die 6. Tiefbohrung wird im Bohrfeld „Lange Trift“ niedergebracht und Bohrturm 6 errichtet (Quelle: NLA WO, 12 Neu, 13 Nr. 46086).
1940 wurden die 7. und 8. Tiefbohrung niedergebracht und die Bohrtürme 7 und 8 errichtet. Die BKB übernahm das Kraftwerk von der ÜZH. Carlshall erzeugte 5.950 t und Neuhall 64.100 t Salz.
Neuhall 1940 – 1970
Während des 2. Weltkrieges produzierte die Saline an der Kapazitätsgrenze. Mit der Kapitulation wurde die Saline von den Alliierten geschlossen, konnte den Betrieb nach 6 Wochen aber wiederaufnehmen, da die Energieversorgung aus dem Kraftwerk der B.K.B. mit Dampf und Strom sichergestellt war. So konnte die Saline Neuhall 1945 40.300 t Salz erzeugen, während Carlshall nur 1.650 t ersieden konnte. Da die anderen Salinen wegen des herrschenden Brennstoffmangels kaum produzieren konnten, lieferte Schöningen bis zur Währungsreform gut 2/3 des Siedesalzbedarfs in Norddeutschland.
Unmittelbar nach der Währungsreform wurde mit der Planung der zu erneuernden Werksanlagen begonnen. Man entschied sich aus Kostengründen die Salzerzeugung komplett auf die Vakuumtechnik umzustellen. Es wurde 1950 bei der Escher Wyss A.G. eine fünfstufige Brüdenverdichtungs- und Verdampfungsanlage bestellt. Der Umbau der Saline erfolgte in den Jahren 1950 -1953 mit einem Kostenumfang von ca. 5 Mio. DM. Da mit der neuen Anlage eine Kapazitätssteigerung von 50.000 t auf 100.000 t Jahreserzeugung möglich war, mussten auch alle anderen Betriebseinrichtungen erweitert bzw. erneuert werden.
Die Sieberei wurde erneuert, die Vortrocknung durch weitere Schubschleudern vergrößert und ein neuer Ringetagentrockner eingebaut.
Das Vakuumverfahren erforderte eine Solereinigungsanlage, die alle Rohsolebestandteile, die Kesselstein bilden, entfernten. Es wurde mit Erfolg ein neues Verfahren eingesetzt, mit dem ein Siedesalz von 99,95% NaCl Reinheit erzeugt werden konnte.
Die Saline Schöningen war nach dem Umbau mit einer Jahreskapazität von bis zu 110.000 t die größte und modernste Saline in der damaligen Bundesrepublik.
Der Absatz des Schöninger Siedesalzes musste nach 1945 in Eigenregie erfolgen. Es wurde eine eigene Verkaufs- und Vertriebsabteilung aufgebaut, der es erfolgreich gelangt, die Kunden vom Pfannensalz auf das Siedesalz umzustellen und neue Kunden auch wieder im Ausland zu gewinnen.
Nach der Stillegung des Kraftwerks musste 1964/65 eine eigene Energieversorgung gebaut werden. Zur Versorgung wurde jeden Monat ein Kesselwagenzug mit 1.000 t Öl benötigt. Durch den Entfall des kostengünstigen Niederdruckdampfes vom Kraftwerk, verschlechterte sich die Wirtschaftlichkeit der Saline.
Bereits Anfang der fünfziger Jahre war von der niedersächsischen Landesregierung die Braunschweig G.m.b.H. in die Niedersachsen GmbH eingegliedert worden. Das gesamte Stammkapital der Holdinggesellschaft in Höhe von 11,4 Mill. DM befandet sich zu 81,2 v. H. in Händen des Landes Niedersachsen [Quelle: www.zeit.de/thema/niedersachsen] und zum Rest beim Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfond.
Anfang der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts beschlossen der Aufsichtsrat der Niedersachsen GmbH und die Preussag zusammen mit der Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in Hengelo die Norddeutsche Salinengesellschaft mbH zu gründen. In die neue Gesellschaft wurden die Salinen Schöningen und Lüneburg eingebracht.
Obwohl die Saline Schöningen im Jahr 1967 noch 155.000 t Salzfracht versandt hatte, wurde am 21.06.1968 beschlossen, die Saline zum 31.08.1970 stillzulegen und die Salzerzeugung komplett in die neue Saline Stade zu verlagern. In Stade sollte das nahgelegene Atomkraftwerk die Energie liefern.
(Quelle: Die Geschichte der Saline Schöningen, Hrsg. Saline Schöningen der Niedersachsen GmbH, 1961)
Das Kraftwerk
Am 9.2.1909 schließen das Herzogliche Braunschw. Lüneb. Staatsministerium und die Braunschweiger-Schöninger Eisenbahnaktiengesellschaft (B-S-E) einen Vertrag zur Belieferung der neuen Saline mit Dampf und Strom durch das von der B-S-E zu errichtende Kraftwerk. Die Belieferung sollte zum 1.4.1910 beginnen. Der Vertrag wurde für 20 Jahre geschlossen und war von beiden Seiten unkündbar (NLA WO, 12 Neu 14, Nr. 246).
Die Westdeutsche Eisenbahngesellschaft, Köln (WEG), Eigentümer der B-S-E, gründete 1909 die Braunschweigische Elektrizitäts-Betriebsgesellschaft mbH, Schöningen (BEB) mit dem Ziel, das Kraftwerk in Schöningen zu errichten. Vorgesehen war primär die Elektrifizierung der Oschersleben-Schöninger (O-S-E) und der Braunschweig-Schöninger Eisenbahn (B-S-E); ferner sollten auch 190 Ortschaften mit Strom versorgt werden. Der Plan, die OSE und die BSE zu elektrifizieren, wurde nach kurzer Zeit fallengelassen; angeblich war der Gleisunterbau zu schwach für Elektrolokomotiven.
Nach Inbetriebnahme belieferte das Kraftwerk die Stadt Schöningen mit Strom (3000 V, Drehstrom). Neben der Saline waren auch in Nachbarschaft errichtete Gewächshäuser, in denen die „Schöninger Gurken“ und anderes Gemüse gezüchtet wurden, Abnehmer des Abdampfs aus dem Kraftwerk.
Das Kraftwerk bezog die zur Verfeuerung erforderliche Braunkohle zunächst per Bahntransport aus der Grube Caroline bei Völpke.
Ab dem 1.10.1921 wurden das Schöninger Kraftwerk und die von der B-E-B errichteten Versorgungsanlagen von der ÜZH gepachtet. 1936 ging das Vermögen der BEB an die ÜZH über. Als Folge des 1935 erlassenen Energiegesetzes wurden Energieerzeugung und -verteilung getrennt und das Kraftwerk Schöningen im Jahr 1940 an die Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke AG, Helmstedt (BKB) verkauft.
lm Jahr 1929 wurde ein neues Kesselhaus gebaut. Eine am 19.04.1929 in Betrieb genommene 4 km lange Materialseilbahn (Hersteller war die Firma Mackensen aus Schöningen) übernahm die Kohlenversorgung aus der BKB-Grube Treue. Im Maschinenhaus des Kraftwerkes wurde eine 2.750 kW Gegendruck Dampfturbine aufgestellt. Die vorhandene Zwillingskolbendampfmaschine diente als Reserve. Die Abdampfmenge für die Saline wurde auf 30 t/h erhöht. Produziert wurde weiterhin Drehstrom mit einer Spannung von 3000 V. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit wurde ein 50 kV / 3 kV-Umspannwerk gebaut und mit der 50 kV-Sammelschiene des Kraftwerks Harbke verbunden.
Das Kraftwerk Schöningen wurde durch das Kraftwerk Offleben unrentabel und am 15.01.1965 stillgelegt; der Abriß erfolgte im Jahr 1966. Der 54 m hohe Schornstein wurde am 30.09.1966 gesprengt.
Die Saline musste daher in 1964 eine eigene Energieerzeugung aufbauen. Zu Deckung des Energiebedarfs wurden pro Monat 1.000 t Heizöl benötigt, das per Bahn angeliefert wurde.
Bahnanschluß Neuhall
Im Vertrag mit der B-S-E vom 9.2.1909 wurde folgendes vereinbart:
„Vl. Gleisanlagen.
§ 23. Den für die Gesamtanlage erforderlichen Bahnanschluss an die Oschersleben- Schöninger Eisenbahn einschließlich des Hochgleises für die Kohlenzufuhr und des Tiefgleises für die Salzabfuhr hat das Kraftwerk auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Die Anordnung der Gleisanlagen ist mit der Saline zu vereinbaren. Die Schienenoberkante des Tiefgleises darf an der Ladestelle nicht weniger als 2 m unter Schienenoberkante des Bahnhofsgleises liegen.“ (Quelle: NLA WO, 12 Neu 9, Nr. 2475)
Damit verfügte die Saline Neuhall übereinen direkten Bahnenschluss, was den Versand des Salzes wesentlich förderte.
1920 -1921 wurde der Umbau des Anschlussgleises erforderlich, da das Gefälle des Zufahrtgleis 1:40 zu groß und das Abstellgleis zu kurz war, was zu Unfällen führte. Das max. zulässige Gefälle durfte 1:400 betragen. Investitionen zum Verschieben mit einer Winde waren zu hoch. Die Kosten für den Umbau und die Erweiterung betrugen 127.500 RM für die Saline und 52.500 RM für die B.E.B (Quelle: NLA WO,12 Neu, 13 Nr. 46082).
1949 werden in der Saline 150 t bis 200 t Siedesalz pro Tag erzeugt. Zum Abtransport wurden täglich 12 bis 15 Eisenbahnwaggons über das Anschlussgleis bewegt. Die Länge der Verladehalle ist für 8 bis 9 Waggons bemessen. lm Rahmen eines Umbaus wurde das Anschlußgleis der Saline verlängert und über eine Weiche an das Gleis 5 des Bahnhofs Schöningen-Süd angeschlossen.
1956 wurde bei der Saline ein zweites Gleis eingebaut, das mit einer Gleiswaage ausgerüstet wurde und der Losverladung diente. Ausgelegt war dieses Gleis zum Abstellen von vier Waggons. Die Bedienung des Anschlusses erfolgte einmal pro Tag durch die BSE. Entsprechend einem Abkommen zwischen der DB und der BSE konnte die Bedienung bedarfsweise auch mehrfach pro Tag durch die DB mit der im Bahnhof Schöningen stationierten Diesellok (Köf ll) erfolgen.
Nach Stillegung des Kraftwerks wurde 1964/65 von der Saline eine eigene Energieversorgung gebaut. Zur Versorgung wurde jeden Monat ein Kesselwagenzug mit 1.000 t Heizöl angeliefert. Der Zug verkehrte von Hamburg (bzw. Spelle) nach Schöningen.
Nachdem die Saline in Schöningen als letzter Großkunde der BSE ihren Betrieb zum 31.08.1970 einstellte, stellte auch die BSE ihren Güterverkehr am 30.06.1971 ein.
(Quelle: Der Bahnhof Schöningen-Süd als FREMOdul (Sng), www.spicher-online.de)
Bohrfelder
Bohrfeld Walkmühle – Grasmühle
Tiefbohrung I an der WalkmühleBohrbeginn 1845, Salzfund bei 571 m 1847, ab Mai 1848 Soleförderung
Tiefbohrung II an der Walkmühle
Bohrbeginn 1849, Salzfund bei 542 m 1853 und ab Ende 1853 Soleförderung
Die beiden Bohrlöcher lieferten ab 1848 bzw. 1853 bis Ende 1889 an Sole 702.476 m³. Das entspricht bei 25 % Salzgehalt und einem spez. Gewicht von 1,192 einer möglichen Salzproduktion von 209.337 t.
Tiefbohrung III an der Grasmühle
Bohrbeginn 1855, Salzfund bei 568 m 1861, danach Inbetriebnahme
Bohrfeld Lange Trift
Tiefbohrung IV wurde 1913 im Bohrfeld an der „Langen Trift“ niedergebracht, Bohrbeginn März 1913, Teufe: 374,0 m erreicht Dezember 1913
Tiefbohrung V, Bohrbeginn November 1925, Teufe: 390,77 m erreicht Juli 1926
Tiefbohrung VI, Bohrbeginn April 1936, Teufe: 397,73 m erreicht August 1936
Tiefbohrung VII, niedergebracht Frühjahr 1940, Teufe: 420 m
Tiefbohrung VIII, Bohrbeginn 24.10.40, Teufe: 399,8 m erreicht 19.12.1940
Tiefbohrung IX, Bohrbeginn Mai 1959, Teufe: 424,50 m erreicht November 1959
An der „Langen Trift“ wurde ein Solespeicher für den Bohrturm IV errichtet, der über Solgefluder mit dem Bohrturm IV verbunden war. Neben dem Solespeicher wurde um 1938 ein Maschinenhaus für die Druckluftanlage und die Wasserpumpen gebaut. Die Maschinen standen vorher einzeln bei den Bohrtürmen. Es standen jetzt 6 Maschinen für die Soleförderung.
Die Kompressoren erzeugten die Druckluft, mit der die Sole aus den Kavernen an die Erdoberfläche gedrückt würde. Für die Soleförderung wurde ein Doppelrohr eingesetzt. Im inneren längeren Rohr stieg die Sole auf, wenn durch den Zwischenraum zwischen dem äußeren und dem inneren Rohr komprimierte Luft auf den Solespiegel gepresst wurde.
Die Sole floß vom Solespeicher durch Leitungen mit 175 mm Durchmesser mit dem natürlichen Gefälle zur Saline.
Wann die Bohrlöcher I, II und III verschlossen wurden ist feststellbar. Sie wurden nicht mehr in den Plänen aufgeführt, die für die Schließung der Bohrlöcher IV – IX 1970 bei der Stillegung der Saline erstellt wurden.
Die ausführlichen Pläne und Unterlagen werden auf einer Stellwand im OG gezeigt.
(Quellen: Heimatbuch der Stadt Schöningen III. Teil von Karl Rose, 1940 Hrsg. Stadt Schöningen; NLA HA BaCl Nds. 540 Acc. 2 Nr. 573)
Salzverkauf und Vertrieb
Der Verkauf des Schöniger Salzes wurde bis 1770 von Salzführern oder Salzfuhrleuten durchgeführt. Sie waren selbständig, nahmen den Salzkotenbesitzern das Salz zu festen Preisen ab und verkauften es dann im Lande auf eigene Rechnung. Von den Fuhrleuten um 1710 sind einige namentlich bekannt: Martin und Heinrich Holtheuer, Heinrich und Hans Sachtleben, Jürgen -, Carl – und Martin Schliephake sowie Hans Sievers.
In der Schöninger Umgebung und den näheren Orten wurde das Salz meisten von Karrenschiebern vertrieben.
Bereits der Vorgänger von Herzog Carl, Ludwig Rudolf, hatte den Absatz des Schöninger Salzes durch Erlasse im Braunschweiger Land gefördert. Zwischen 1768 und 1770 unterboten andere Salinen die Schöninger Salzpreise massiv und schadeten damit der herzoglichen Saline. Herzog Carl ließ deshalb Salzfaktoreien einrichten, denen feste Versorgungsgebiete zugewiesen wurden. Er beendete damit den freien Salzhandel. Gleichzeitig belegte er das Salz mit einer Verbrauchssteuer von 4 Pfennig pro 44 Pfund. Damit sicherte er der Saline eine gesicherte Absatzmenge.
Während der französischen Herrschaft hatte die Saline an staatliche Salzmagazine zu liefern und erhielt je Zentner nur ein bestimmtes Herstellungsentgeld und die Salzpreise wurden freigegeben. 1813 wurden diese Regelungen wieder rückgängig gemacht.
1850 nach der Stillegung der Saline Salzdahlum wurde der Salzabsatz von der herzoglichen Verwaltung neu geregelt.
Es wurde bestimmt, dass ab dem 1.1.1853 an Stelle von Kaufleuten nur besondere Salzniederlagen das Salz an die Verbraucher verkaufen durfte. Die Salzniederlagen erhielten zu Qualitätssicherung ganz bestimmte Auflagen für die Lagerung des Salzes.
Der Versand des Salzes erfolgte weiterhin durch Fuhrunternehmen, da Carlshall kein Bahnanschluss hatte. Der Transport des Salzes war sehr detailliert geregelt und unterlag etlichen Auflagen.
Seit den 80-er Jahren des 1900 Jahrhunderts gehörte die Saline Schöningen der Salinenvereinigung an – einer Kartell-Organisation, die Absatzquoten für die Mitglieder festlegte. Mit der neuen Saline Neuhall konnte Schöningen Salz aber in großen Mengen zu günstigen Kosten erzeugen und damit die anderen Salinen unterbieten. Gleichzeitig wurde die Konkurrenz der Steinsalzbergwerke bald nach dem ersten Weltkrieg stärker, die die bisherigen Qualitätsmängel des Steinsalzes gegenüber dem Siedesalz durch neue Verfahren zu beseitigen versuchten. Da die Saline Schöningen wegen der Kopplung an das Kraftwerk die Produktion nicht beliebig reduzieren konnte, musste sie neue Märkte jenseits der Quote erschließen. Deshalb trat das Schöningen Salinenamt 1922 aus der Salinenvereinigung aus.
Das Salz wurde dann im gesamten Reich abgesetzt, in die Länder Holland, Dänemark und Schweden geliefert und auch nach Nordamerika und Afrika exportiert. Für die Qualität des durch das Vakuumverfahren gewonnenen Salz spricht, dass das Schöningen Buttersalz in der Lebensmittelindustrie bevorzugt wurde. Die Saline konnte ihren Absatz von 24.144 t in 1922 auf 36.788 t in 1927 steigern.
Zum 1.1.1928 wurde das Norddeutsche Siedesalz-Syndikat gegründet. Die Inlandquote betrug für das Schöningen Salinenamt 9,27% und 5,598% im Ausfuhrverband deutscher Salinen.
Die Wirtschaftkrise zwangen das Schöningen Salinenamt zum 31.12.1932 das Norddeutsche Siedesalz-Syndikat zu kündigen. Nach Verhandlungen wurde das Syndikat weiter geführt. Das Schöningen Salinenamt erhielt jetzt eine Quote von 13,5%.
Die Absatzprobleme waren aber damit nicht auf Dauer beseitigt. Unter erheblichen finanziellen Opfern wurden Siedesalz an die chemische Industrie und andere Verwertungen geliefert. Die Absatzmenge konnte so auf 43.674 t in 1932 gesteigert werden.
Der Wettbewerb zwischen den Salinen und den Salzbergwerken wurde per Gesetz zum 1.1.1934 beendet. Alle Betriebe wurden im „Deutschen Salzbund“ zum Zweck der Absatzaufteilung zusammengeschlossen. Die Saline Schöningen erhielt eine Quote von 12,3936% für den In- und Auslandsabsatz. Darüber hinaus bekam die Saline einige Sonderrechte.
Nach Kriegsende wurde der „Deutschen Salzbund“ als Kartell von den Alliierten verboten.
Es musste eine eigene Verkaufs- und Vertriebsabteilung aufgebaut werden, der es auch erfolgreich gelangt, nach dem Einbau der neuen Verdampferanlage die Kunden vom Pfannensalz auf das Siedesalz umzustellen und neue Kunden auch wieder im Ausland zu gewinnen.
(Quellen: Heimatbuch der Stadt Schöningen III.Teil von Karl Rose, 1940 Hrsg. Stadt Schöningen; Geschichte der Saline Schöningen, Hrsg. Saline Schöningen 1961).
Eigentümerentwicklung ab 1924 und Schließung der Saline
Die Verwaltung und Ausbeutung des staatlichen ( ehem. herzoglichen) braunschweigischen Grund- und Bergwerksbesitzes – zu dem die Schöninger Saline gehörte – wurde der Braunschweig G.m.b.H. aufgrund des Gesetzes vom 15.10.1924 vom braunschweigischen Staatsministerium mit Wirkung vom 1.4.1924 übertragen. Dazu gehörten auch die sonstigen ertragswirtschaftlichen Betriebe, die sich in staatlicher Verwaltung befanden. Die gesamten Geschäftsanteile der G.m.b.H in Höhe von 1 Million Goldmark befanden sich darauf im Besitz des braunschweigischen Staates. (Quellen: Heimatbuch der Stadt Schöningen III. Teil von Karl Rose, 1940 Hrsg. Stadt Schöningen; Geschichte der Saline Schöningen, Hrsg. Saline Schöningen 1961).
1949 Jahre beschloß der Niedersächsische Landtag auf Betreiben der von Hinrich Wilhelm Kopf geführten Landesregierung die Braunschweig G.m.b.H. in die neugegründete Niedersachsen GmbH trotz der Widerstände aus Braunschweig einzugliedern. Das gesamte Stammkapital der Holdinggesellschaft in Höhe von 11,4 Mill. DM befand sich darauf zu 81,2 v. H. in Händen des Landes Niedersachsen und zum Rest beim Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfond (Quelle: www.zeit.de/thema/niedersachsen).
Die neuen Eigentümer genehmigten 1950 -1953 ein Investitionsprogramm von 5 Mio. DM zur Modernisierung, mit dem eine sehr wirtschaftliche Vakuumanlage zur Soleverdampfung in die Schöninger Saline installiert wurde. (siehe Neuhall 1940-1970). Die wirtschaftlich erfolgreiche Schöninger Saline muß erheblich dazu beigetragen haben, die Verluste der Niedersachsen GmbH aus anderen Beteiligungen auszugleichen (Quelle: DER SPIEGEL, Mittwoch, 30.3.1955, Niedersachsen GmbH „Nur keine Trauergemälde“).
In Zuge des Abbaus von Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Wirtschaftsunternehmen suchte man Interessenten für die Salinen Schöningen und Lüneburg. Mit der Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in Hengelo und der Preussag wurde die Norddeutsche Salinengesellschaft mbH gegründet. In die neue Gesellschaft wurden die Salinen Schöningen, und Lüneburg eingebracht. Die Saline Stade, die seit 1873 Siedesalz erzeugte und um 1960 von der Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie übernommen worden war, gehörte damit ebenfalls zur Norddeutschen Salinengesellschaft mbH.
Am 25.6.1962 wurde mit Wirkung vom 2.3.1962 die Norddeutsche Salinengesellschaft mbH mit Sitz in Hannover als Eigentümer des Bergrechtes und der Saline ins Berggrundbuch eingetragen (Quelle. Abschrift Amtsgericht Schöningen, NLA HA BaCl Nds. 540 Acc. 2 Nr. 573)
1962 begann die Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in Stade mit dem Bau einer neuen Saline, die 1964 den Betrieb aufnahm. Ab 1960 bis 1964 gingen die einzelnen Blöcke des Kraftwerks Schilling in Stade in Betrieb. Das Kraftwerk lieferte die benötigte Energie. Ab 1984 versorgte das Kernkraftwerk Stade die Saline Stade über Prozeßdampfauskopplung mit Energie bis zu seiner Stillegung im Oktober 2003, woraufhin die Saline Stade von den Eigentümern Akzo Nobel bereits Ende Juni 2003 stillgelegt wurde. Die Produktion wurde nach Holland und Dänemark verlagert. Akzo Nobel hatte 1969 Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie übernommen.
Vor diesem Hintergrund muß die Entwicklung der Schöninger Saline gesehen werden. 1965 wurde das Kraftwerk stillgelegt, das bisher kostengünstig Energie geliefert hatte. Für die Saline mußte daher 1964 eine eigene Energieerzeugung gebaut werden. Als dann 1968 notwendige Investitionen von etlichen Millionen DM anstanden, um die Produktion zu modernisieren, wurden diese von den Eigentümern nicht genehmigt. Es wurde vielmehr die Stillegung der Schöningen Saline zum Jahr 1970 beschlossen.
Nach Bekanntwerden der Stillegungspläne hatte die Stadt Schöningen 2 Jahre Zeit, ein umsetzbares Konzept zur Nachnutzung der Saline und des Bohrfeldes zu erarbeiten. Die Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und der Norddeutsche Salinengesellschaft mbH als Eigentümer verliefen offensichtlich gemäß der Zeitungsartikel (Quelle BZ vom 3.1.1970; BZ vom 15.1.1970; Schöninger Anzeiger vom 13.1. und 15.1.1970) mißverständlich und nicht konstruktiv. Die Vorstellung der Stadtverwaltung hinsichtlich des Kaufpreises müssen deutlich unter dem Angebot des Bauunternehmers Kretschmar gelegen haben, dem die Saline mit dem gesamten Gelände am 3.1.1970 verkauft wurde.
Die Verwaltung und der Rat der Stadt Schöningen unter Bürgermeister Grau sahen 1968-70 noch nicht die Chance, die Saline und das Bohrfeld als Museum für die Entwicklung des Tourismus zu nutzen, wie es die Stadt Lüneburg 1980 bei Stillegung der dortigen Saline schaffte.
Nachdem die Verpachtung der Saline durch Kretschmar an die Norddeutsche Salinengesellschaft mbH mit der Stillegung zum 31.08.1970 ausgelaufen war, wurden die meisten Gebäude der Saline abgerissen. Die verbleibenden Gebäude – Verwaltungsbau, Turbinenhalle, Werkstattgebäude – wurden einzeln verkauft.
Zum Verbleib des Archivs des herzoglichen Salinenamtes, das in der Saline aufbewahrt wurde, gibt es bisher keine nachvollziehbaren Informationen.
Die Bohrtürme im Bohrfeld wurden abgerissen, und die Bohrlöcher unter der Aufsicht des Bergamtes von der Norddeutsche Salinengesellschaft mbH verschlossen, da sich für die artesischen Wasserzuflüsse „keine Verwendung“ fand (Quelle: Schreiben vom 20.4.1970 Landkreis Helmstedt an das Bergamt; NLA HA BaCl Hann. 184 ACC. 21 Nr. 789).
Das Bohrfeld wurde nach Aufhebung des Bergrechts am 1.10.1974 als Baugebiet von der Stadt Schöningen erschlossen (Quelle: NLA HA BaCl Hann. 184 ACC. 21 Nr. 789).
Quellen:
Archiv Heimatmuseum, Landesarchiv Niedersachsen WO und HA BaCL (Veröffentlichungsgenehmigungen liegen vor), Stadtarchiv Schöningen. Quellenangaben siehe Text.
Herausgeber: Heimatverein Schöningen und Umgebung e.V., Markt 33/ Schulstraße 1, 38364 Schöningen
Texte: Heinrich Ahrens
Vervielfältigungen oder Veröffentlichungen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Vereins und der angegeben/ zitierten Quellen zulässig.
Schöningen: 10/2025
Anhang: Das Salzmännchen
Im Zuge der Vorbereitung zur Salinenausstellung wurde immer wieder thematisiert, dass es zur Betriebszeit der Saline ein sogenanntes Salzmännchen gab, eine Steinfigur die an einem Gebäudeteil angebracht war.
Weitere Recherchen bei den damaligen Aufkäufern der Gebäude, u.a. in Kanada, förderten dann zutage, dass dieses Männchen noch heute existent ist.

Er war seinerzeit an dem Gebäude angebracht, in welchen heute das THW seine Unterkunft hat. Man kann den ehemaligen Ort oberhalb der Tür an den etwas dunkleren Klinkern erkennen.
Am heutigen Aufstellungsort konnte auch ein Foto des Salzmännchens gefertigt werden.

